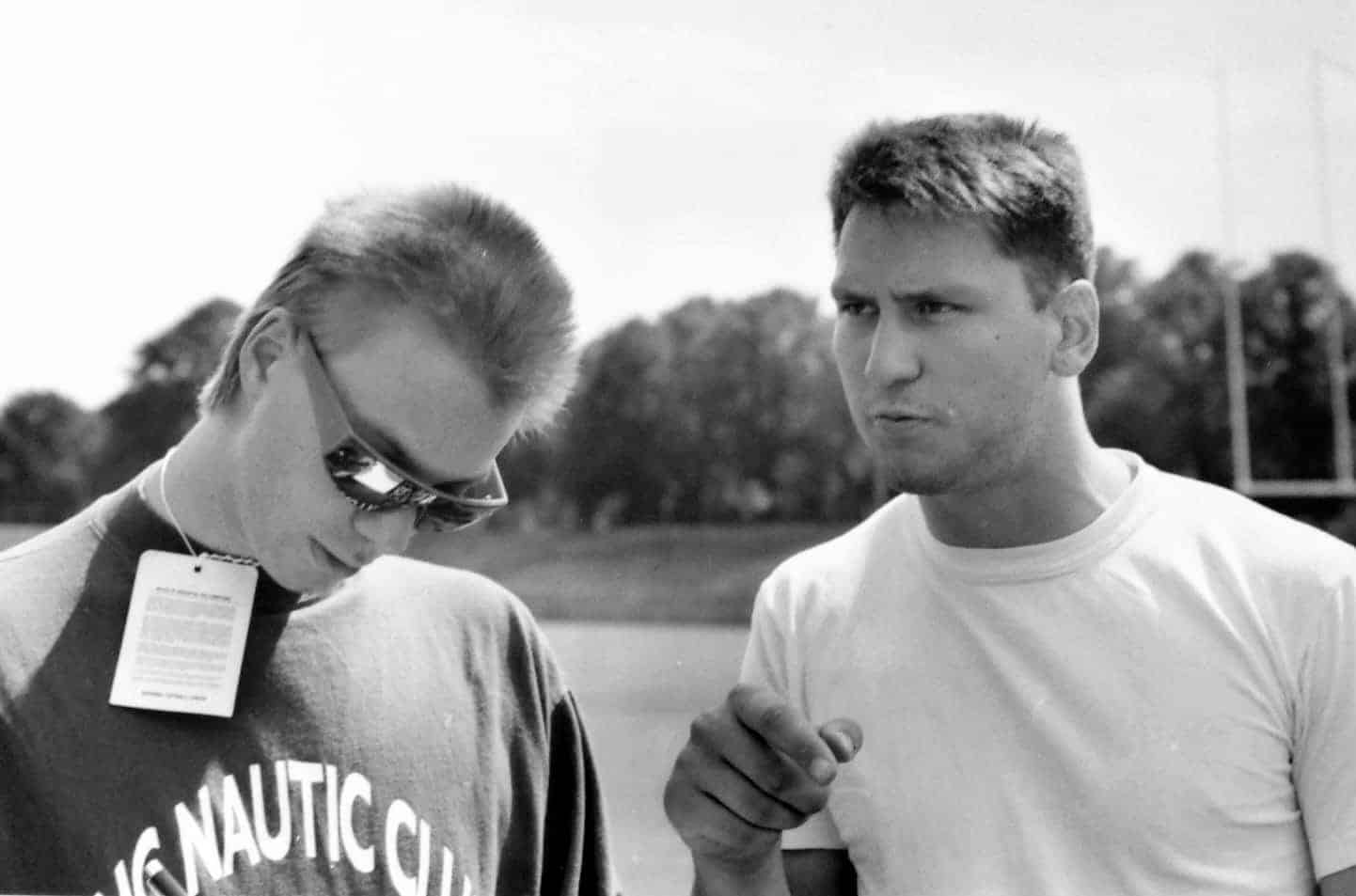Ich berichte seit 35 Jahren über American Football. Ich habe viel erlebt. Superstars getroffen. Interviewt. Aber das? Das war anders.
Olympiastadion, Berlin.
November. Acht Grad. Nieselregen wie feiner Staub in der Luft. 72.203 Menschen in dicken Jacken, Mützen, Schals. Aus allen Richtungen kamen sie, in allen Farben. Colts-Blau, Falcons-Rot, dazwischen Kinder mit Deutschlandflagge auf der Wange, ein Mann in einem geblümten Hawaiihemd, weil man ja irgendwo immer Sommer sein will.
Der Geruch: Bratwurst, nasser Beton, ein Schuss Bier. Plastikbecher klopfen gegeneinander, dumpf, nicht klirrend, eher wie zwei Hände, die kurz applaudieren. Irgendwo läuft „Living on a prayer“. Jemand pfeift mit, zu spät, aber mit Überzeugung.
Die Stände überlaufen. Menschen stehen Stunden für eine Kappe an, als ginge es um den Eintritt ins Paradies. Ich wollte auch eine, natürlich – ich sammele Mützen wie andere Briefmarken – aber irgendwann wurde die Schlange ein Lebewesen. Endlos, dampfend, schwatzend, atmend. Ich ließ sie ziehen. Ich wollte das Spiel sehen, nicht seine Schattenwirtschaft.
Dann die Choreo. Am Tag des Mauerfalls.

„Winds of Change“. Kaltblauer Himmel, den niemand sieht, weil er verdeckt ist. Goldene, rote, schwarze Flächen, flatternd im Wind. Ich war Winkelement 6505. Ein goldener Punkt in einem Bild, das um die Welt ging. Mit Bedienungsanleitung, die auf jedem Sitz gelegt war. Phase 3: Schwenken. Vor mir Fahnen. Neben mir Fahnen. Hinter mir Fahnen. Ich hob den Arm, mechanisch, glücklich. So fühlt sich Gruppendynamik an, dachte ich. Vielleicht auch Zugehörigkeit. Ich war ein Pinselstrich im großen Gemälde kollektiver Rührung.

Später sehe ich auf Instagram, was ich selbst nicht sehen konnte. Das Stadion als Herzschlag. Pulsierend.
Ich war mittendrin – und blind zugleich.
Dann der Lärm. Musik.
„Hey Baby“. „Country Roads“. „99 Luftballons“. „Völlig losgelöst“.
Die Stimme von HP Baxter wie eine Tröte aus einem anderen Universum. Live. Auf dem Rasen.
„Dödödödödödödödö!“
72.000 Kehlen antworten. Es klang, als hätte jemand das kollektive Kindsein neu gestartet.
Die Videowalls übersetzen alles phonetisch in unfreiwilliger Poesie:
„Steh auf den Beinen!“
Ich lächle. German for runaways, denke ich, Otto hätte seinen Spaß gehabt. Und fühle mich plötzlich wie Teil eines großen, schrägen Theaterstücks, bei dem niemand genau weiß, wer Publikum ist und wer Darsteller.
Und überall Englisch.
Am Bierstand. Am Grillstand. Auf den Rängen. Diese absurde Internationalität im heimischen Wohnzimmer.
„Excuse me, is this seat free?“
„Yeah, sure, no problem!“
Sogar mit meiner Sitznachbarin.
Wir reden eine halbe Stunde so, höflich, bemüht, bis wir merken: wir kommen beide aus Berlin.
Ein Moment der Erkenntnis – dann lachen wir. Laut. Und frieren gemeinsam weiter. Transatlantisch. Mit Berliner Akzent.
Das Spiel war spannend, ja. Indianapolis gewinnt in der Verlängerung. Aber wichtiger war das Dazwischen: das Warten, das Summen, das gemeinsame Atmen im Dampf des Novemberabends.
Vor mir ein Junge. Falcons-Mütze, Colts-Trikot. Jubelt für beide. Ich nicke ihm zu. Er versteht etwas, das wir vielleicht verlernt haben. Dass es gar nicht darum geht, wer gewinnt. Sondern darum, da zu sein. Teil zu sein.
Berlin feierte Football. Und sich selbst.
Ein Fest im Grau.
Ein leuchtendes, atmendes Bild aus Trikots, Plastikbechern, Fahnen, Stimmen, Wir.
Ein Herz, das kurz im Takt schlug – warm, laut, lebendig.
Und ich – der alte Reporter –
stand mittendrin und wusste:
Das hier war kein Spiel.
Das war ein Gefühl. Und das kommt in meine Top 10.

Ronald Toplak, geboren am 5. Februar 1965 in Berlin, ist seit über 30 Jahren im Sportjournalismus für verschiedene Hauptstadt-Medien tätig. 25 davon als Redakteur beim Berliner Kurier. Er schreibt – nach einer gesundheitlichen Auszeit – nun als freier Autor.